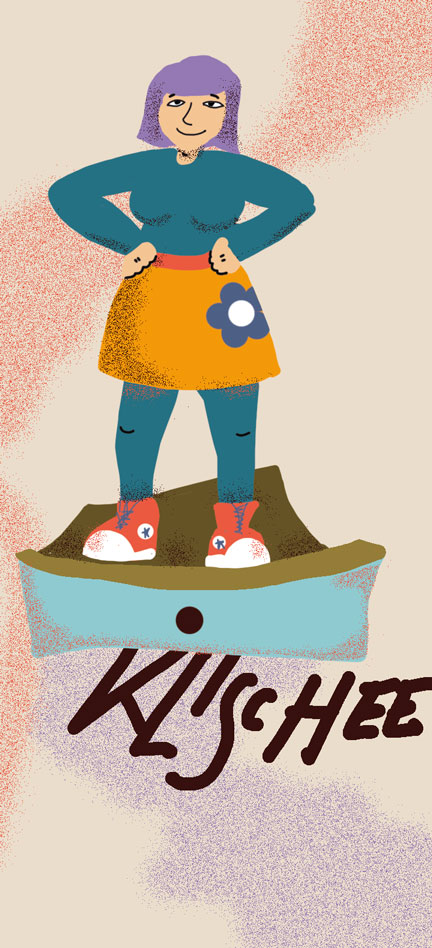Unbewusste Vorurteile beim Schreiben
Gut gemeint vs. gut gemacht: Selbst wenn du deinen Content bewusst diverser und inklusiver gestalten möchtest, kannst du ungewollt Diskriminierung reproduzieren. Kein Wunder, denn Kommunikation ist komplex. Deshalb bringt es auf Dauer nichts, sich an Do’s and Don’ts entlang zu hangeln. Ein tieferes Verständnis von Diversität und Inklusion muss her. Bekommst du, indem du dich beim Schreiben zum Beispiel mit deinen unbewussten Vorurteilen aka Unconscious Bias auseinandersetzt. Denn davor schützt leider auch die stabilste Haltung nicht.
Viele von uns halten sich für weltoffen, fair und objektiv. Aber Moment mal: Wie kann es da sein, dass immer noch Menschen aus bestimmten Gruppen strukturelle Diskriminierung erfahren, zum Beispiel auf dem Wohn- und Arbeitsmarkt? Liegt das etwa an allen anderen, nur nicht an uns persönlich? Spoiler: Leider nein. Wir alle tragen ungewollt dazu bei. Ein Grund hierfür ist der sogenannte Unconscious Bias, der sich auch in deinem Content spiegelt.
Was bedeutet Unconscious Bias?
Der Begriff Unconscious Bias kommt aus dem Englischen und bedeutet auf Deutsch so viel wie unabsichtliche Voreingenommenheit oder unbewusste Vorurteile. Und die haben ausnahmslos alle. Das liegt daran, dass unser Gehirn uns gern Streiche spielt: Rund 90% unserer Denkprozesse laufen automatisch ab.
Dabei kommt es zu mentalen Abkürzungen und systematischen Denkfehlern, die in der Psychologie kognitive Verzerrungen genannt werden. Bezieht sich eine kognitive Verzerrung auf soziale Gruppen und Kategoriedenken, spricht man von Unconscious Bias oder Implicit Bias. Unconscious Bias aka unbewusste Vorurteile basieren meist auf Stereotypen und Klischees – also Assoziationen, die gesellschaftlich etabliert sind.

Warum unbewusste Vorurteile für Redakteur*innen relevant sind
Unconscious Bias verbreitet sich besonders gern über Narrative, also bestimmte Erzählmuster – ein Grund, warum Content Creator*innen, Redakteur*innen und Texter*innen beim Eindämmen von Diskriminierung eine Schlüsselrolle zukommt. Mal abgesehen von der gesellschaftlichen Verantwortung: Eine diskriminierungs-sensible Kommunikation ist die Voraussetzung dafür, dass unterschiedliche Adressat*innen sich mit deinem Content identifizieren und sich von dir respektiert fühlen.
Menschen besitzen ein feines Gespür dafür, ob Inhalte wirklich für sie (und von ihnen) gemacht sind. Wenn du dir also soziales Engagement und Diversität auf die Fahne geschrieben hast und nicht ablieferst, passiert folgendes: Zum einen leidet deine Glaubwürdigkeit. Zum anderen kaschiert Diversity als rein symbolische Bemühung („Virtue Signaling“) ohne wirkliche Veränderung gesellschaftliche Missstände und schadet Betroffenen sogar. Um das zu vermeiden, ist es sinnvoll, sich unter anderem mit dem Thema unbewusste Vorurteile beim Schreiben auseinanderzusetzen.
Beispiele für Unconscious Bias beim Schreiben
Es gibt viele verschiedene Formen von unbewusster Voreingenommenheit. Hier sind ein paar der bekanntesten Arten – mit Beispielen, wie sie die Auswahl deiner Geschichten beeinflussen.
|
Affinitäts-Bias (Affinity Bias, Mini-Me-Bias)
|
Die Tendenz, Personen zu bevorzugen, die dir ähnlich sind oder mit denen du Gemeinsamkeiten teilst. | Beispiel: Du sollst über Rock/Pop-Musiker*innen schreiben. Für deinen Artikel wählst du Bands aus, deren Mitglieder dir ähnlich sind und die in ihren Texten deine eigene Perspektive auf die Welt widerspiegeln. Etwa, indem du als Redakteur rein cis-männlich besetzte Bands aussuchst. Stattdessen könntest du auch queer-feministische Bands zu Wort kommen lassen. |
| Bestätigungsfehler (Confirmation Bias) | Die Tendenz, a) systematisch nach Informationen zu suchen, die dich in deinen bestehenden Annahmen bestätigen oder b) Fakten so zu deuten, dass sie in dein Weltbild passen. | Beispiel: Du schreibst über weibliche Führungskräfte. Weil diese in deiner Vorstellung taff und maskulin erscheinen, suchst du für ein Interview gezielt nach einer Protagonistin, die diesem Bild entspricht. Außerdem wählst du ein entsprechendes Highlight-Zitat aus, das dein Vorurteil bestätigt. Stattdessen könntest du deine Interview-Partnerin weniger stereotyp darstellen. |
| Halo-Effekt | Die Tendenz, einer Person mit einer positiven Eigenschaft weitere wünschenswerte Merkmale zu unterstellen, obwohl es dafür gar keinen Beweis gibt. | Beispiel: Du sollst Protagonist*innen für einen Artikel recherchieren, in dem es um Innovation geht. Du findest einen Unternehmer, der auf einer renommierten Hochschule war. Darum gehst du unbewusst davon aus, dass er besonders innovativ sein muss. Stattdessen könntest du prüfen, ob Entrepreneur*innen mit einem weniger beeindruckenden Lebenslauf nicht eine viel interessantere Neuerung entwickelt haben. |
Unconscious Bias im Content: die Herausforderungen
Unbewusste Vorurteile beim Schreiben lauern überall. Hinzu kommt, dass Redaktionen verschiedene Ansprüche unter einen Hut bringen müssen – angefangen bei Deadlines und kleinen Budgets über Algorithmen bis hin zu aktuellen Trends. Ganz zu schweigen von der Chefredaktion, die am Ende ganz andere Vorstellungen hat als du. Das Ding ist: All das arbeitet für den Unconscious Bias, der dann direkt in deine Themen- und Bildauswahl sowie Textgestaltung einfließt. Auch Hilfsmittel wie KI-Tools fördern unbewusste Vorurteile. Der Grund: Künstliche Intelligenz wird auch an Datensätzen geschult, die nur so vor Klischees und diskriminierenden Narrativen wimmeln. Deshalb ist es beim Schreiben und Bearbeiten von Texten von ChatGPT & Co. enorm wichtig, diese zu hinterfragen. Sonst führen eigene unbewusste Vorurteile zu einer Verzerrung in den Medien: dem sogenannten Media oder News Bias.
Von eigenen Denkmustern zur verzerrten Darstellung: der News Bias
Wer auf Instagram Nachrichtenportalen folgt, kennt sie: die berühmte Zitat-Kachel. Solche Darstellungen reißen Aussagen aus dem Kontext, polarisieren aber schön. Das verzerrt die Realität, aber die Klicks sind sicher. Darum hat Medienkritik seit der Digitalisierung Hochkonjunktur. Allerdings sind journalistische Verzerrungen seit jeher ein Thema – und zum Teil gewollt. Schließlich geht es auch darum, Beobachtungen faktenbasiert einzuordnen. Doch auch hier stellt machtkritisches Denken in Bezug auf verletzliche Gruppen im Allgemeinen einen toten Winkel dar. Deshalb musst du auch achtsam sein, wenn du Informationen aus anderen Medien übernimmst.
| Sensationalismus | Themen so aussuchen, dass sie Angst, Wut oder Erregung erzeugen. | Beispiel: Eigentlich müsstest du keinen unkritischen Content zum Slang-Begriff Talahon entwickeln, der gerade zur unangenehmen Fremdbezeichnung avanciert – aber er klickt so gut … |
| Bildauswahl (Visual Bias) | Bilder auswählen, die die Wahrnehmung von den berichteten Ereignissen oder der allgemeinen Bedeutung der Geschichte verzerren. | Beispiel: In der Headline geht es um Islamist*innen – im Bild sieht man aber unproblematische muslimische Symbole? Diese Wort-Bild-Schere suggeriert, dass alle Muslim*innen extremistisch seien. |
| Falsche Ausgewogenheit | Gegensätzliche Standpunkte gleichberechtigt behandeln, auch wenn es für einen Standpunkt mehr Beweise gibt. | Beispiel: Die Chefredaktion wünscht sich ein Pro und Contra. Neben einer Wissenschaftlerin wird ein Lobbyist befragt. Es wirkt, als seien seine Positionen genauso wichtig wie die der Expertin, deren Einordnung auf Fakten basiert. |
Und jetzt? Unbewusste Vorurteile beim Schreiben vermeiden
Aber wie vermeidest du nun eine ungewollte Voreingenommenheit bei der eigenen redaktionellen Arbeit? Drei wichtige Säulen sind Selbst-Reflexion und Weiterbildung, das Verankern von Diversität und Inklusion in redaktionellen Prozessen sowie Achtsamkeit beim Schreiben.
- Raus aus der Filterblase: Umgebe dich mit vielfältigen Perspektiven. Du kannst ganz niedrigschwellig damit anfangen, zum Beispiel indem du auf Instagram Menschen aus verschiedenen sozialen Gruppen folgst. Hör dir an, was die Menschen wirklich zu sagen haben, die du abbilden möchtest (also: alle). Denk aber dran, dass nicht jede*r von Diskriminierung Betroffene auch Expert*in dafür ist. Um dich weiterzubilden, solltest du auf extra dafür vorgesehene Ressourcen zurückgreifen. Zu denjenigen, die fundierten Content anbieten, gehört zum Beispiel die Anti-Rassismus-Trainerin Tupoka Ogette. Außerdem gibt es im Buchladen deines Vertrauens zahllose kurzweilige Bücher zum Thema. Damit unterstützt du ganz gezielt Menschen, die Diversität, Inklusion und Chancengerechtigkeit Reichweite verleihen.
- Prozesse aufsetzen: Vielfältig aufgestellte Redaktionen sind eine Voraussetzung für diversitäts-sensiblen und glaubwürdigen Content. Dazu gehören junge und alte Menschen, laute und leise und solche, die in unserer Gesellschaft marginalisiert und strukturell diskriminiert werden. Diversity sollte ganz oben aufgehängt sein, und zwar in Content Strategie und Chefredaktion, denn das Thema kann man nicht mal eben nebenbei mitbesorgen. Mit internen Audits, Brainstormings etc. bringt ihr das Thema zusammen nach vorne.
- Inklusiv schreiben: Eine der wichtigsten Stellschrauben für Redakteur*innen ist inklusive Sprache. Wörter mit einem bestimmten Beiklang oder aus bestimmten Kontexten machen oft den Unterschied. Der Rahmen für eine bestimmte Erzählung sollte genau durchdacht werden. Spreche ich aus der Sicht einer Gruppe oder von außen (aus einer machtvollen Position) auf eine Gruppe? Nimm dir Zeit, den Rahmen deines geplanten Narrativs zu reflektieren.
Übrigens: Wenn dein Team noch nicht divers besetzt sein sollte, liegt das möglicherweise daran, dass Unconscious Bias auch bei deinen Personalentscheidungen zugeschlagen hat. Aber das ist eine andere Geschichte und soll an einem anderen Tag erzählt werden.
Quellen und Lesetipps:
Melina Borčak, Mekka hier, Mekka da. Wie wir über antimuslimischen Rassismus sprechen müssen, München 2023
Shakil Choudry, Deep Diversity. Die Grenze zwischen ‚Uns‘ und den ‚Anderen‘ überwinden, Münster, 2017
Floria Moghimi, Fünf Unconscious Bias Beispiele aus dem Joballtag (letzter Zugriff: 22.2.2025)
Benötigst du Unterstützung?

Hi, ich bin Samira, Content Direktorin und Trainerin für diversitäts-sensiblen und inklusiven Content. Ich helfe dir gerne, deine Kommunikation diverser und gerechter zu gestalten.